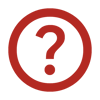Partnerangebot
Fassade dämmen mit Styropor: Vorteile, Nachteile & Alternativen
Energie • Lesedauer: 7 min

Wer dämmt, gewinnt: an Lebensqualität, im Geldbeutel und bei der Klimabilanz. Ein Klassiker unter den Materialien zur Dämmung ist expandiertes Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor. Planen Sie einen Neubau oder eine Sanierung, könnte eine Styropordämmung das Mittel Ihrer Wahl sein. Denn die fachgerechte Wärmedämmung von Fassaden ist einer der größten Hebel, um Gebäude ökologisch und ökonomisch nachhaltiger zu machen. 23 Milliarden Liter Heizöl und 69 Millionen Tonnen CO₂ könnten in Deutschland jährlich eingespart werden, wenn alle sanierungsbedürftigen Gebäude gedämmt würden.
Zudem verbessert eine Wärmedämmung das Raumklima. Denn im Winter bleiben Decken, Wände und Boden warm, im Sommer wird die Hitze dagegen draußen gehalten. Ein Klassiker unter den Materialien zur Dämmung ist expandiertes Polystyrol (EPS), auch bekannt als Styropor. Planen Sie einen Neubau oder eine Sanierung, könnte eine Styropordämmung das Mittel Ihrer Wahl sein.
Inhaltsverzeichnis
Was ist Styropor oder EPS?
Das Dämmmaterial EPS ist den meisten Menschen unter dem Markennamen Styropor geläufig und als Dämmplatten bekannt. EPS ist die Abkürzung für expandiertes Polystyrol. Vereinfacht gesagt, ist Styropor viel Luft und ein wenig Kunststoff. Traditionell wird der Grundstoff Polystyrol aus Erdgas und Erdöl hergestellt und zu Blöcken oder Dämmplatten aufgeschäumt, die zu 98 Prozent aus Luft bestehen.


Häufig wird Styropor als Kern eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) eingesetzt. Ein WDVS besteht aus mehreren Komponenten und Materialien, die auf die Anforderungen eines Gebäudes abgestimmt werden. Das Dämmmaterial Styropor wird heute nicht mehr nur aus fossilen Rohstoffen produziert: Moderne Verfahren gewinnen die Grundstoffe für Styropor, wie beispielsweise Polystyrol, aus organischen Reststoffen.
Wo kann Styropor als Dämmmaterial eingesetzt werden?
Styropor-Dämmplatten, hergestellt aus expandiertem Polystyrol, finden vorrangig in der Wärmedämmung von Gebäuden Anwendung. Die DIN 4108 „Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden“ gibt Aufschluss darüber, wo EPS-Dämmungen eingesetzt werden können:
EPS-Dämmungen sind generell für alle mineralischen Untergründe geeignet, zu denen unter anderem Beton, Mauerwerk, Kalk- und Zementputz sowie Estrich gehören.
Welche Vorteile bietet die Wärmedämmung mit Styropor?
EPS ist weltweit einer der beliebtesten Stoffe zur Dämmung von Gebäudefassaden. Aus gutem Grund: Das Material zeichnet sich durch eine sehr geringe Wärmeleitfähigkeit aus. Im Vergleich zu Standardziegeln dämmt es mehr als zehnmal so gut. Es wird in Dämmplatten produziert und ist daher leicht zu verarbeiten. Zudem ist Styropor langlebig und kostengünstig. Dämmplatten aus Styropor erlauben Ihnen zudem eine gewisse Freiheit: Farbe, Form und Oberfläche können Sie nach eigenen Wünschen gestalten. Verbaut in WDVS mit Mineralwolle-Brandriegel, ist eine Fassadendämmung aus Styropor schwer entflammbar. Sie bildet also einen sehr guten Brandschutz.
Video: Styropor im Dämmstoffvergleich
Welche Nachteile hat Styropor als Dämmstoff?
Styropor weist eine lange Lebensdauer auf, ist aber nicht unkaputtbar. Nach einiger Zeit kann es spröde werden und leichte Risse bekommen. Auch wirkt EPS nicht feuchtigkeitsregulierend – ein Nachteil, wenn es um die Innendämmung von Räumen geht. Das Material bietet zudem keinen Schallschutz.
Wann eignet sich Styropor nicht als Dämmung?
EPS-Dämmplatten bieten zwar in vielen Anwendungsbereichen gute Eigenschaften, jedoch gibt es Situationen, in denen sie nicht die optimale Wahl darstellen. So sind sie beispielsweise für die Zwischensparrendämmung bei Satteldächern nicht geeignet. Der Grund liegt in den sich bewegenden Holzbalken des Daches, denen das starre Polystyrol der EPS-Platten nicht folgen kann, was zu Fugen und unerwünschten Wärmebrücken führen würde. Ebenso verhält es sich bei der Dämmung von Flachdächern, auf denen häufig Bitumen verklebt wird. Die dabei entstehende Hitze würde die EPS-Platten beschädigen und ihre isolierende Wirkung beeinträchtigen. Bei der Dämmung von Raum- und Trennwänden hingegen spielt neben dem Wärmeschutz auch die Schalldämmung eine wichtige Rolle. Da EPS-Dämmplatten in dieser Hinsicht keine zufriedenstellenden Eigenschaften aufweisen, sind sie auch für diese Anwendung weniger geeignet.
Worauf muss bei der EPS-Dämmung geachtet werden?
Beim Einsatz von EPS-Dämmplatten ist deren Brandverhalten ein wichtiger Faktor, welcher durch den B-Wert beschrieben wird. Es gibt verschiedene Klassen, von denen die Klasse B1 als schwer entflammbar gilt und somit die sicherste Option darstellt.
Was sagt der B-Wert aus?
Der B-Wert ist eine Kennzeichnung für das Brandverhalten von Baustoffen. Er gibt an, wie stark ein Material Feuer verbreitet. Je höher der B-Wert, desto höher die Brandgefahr.
Die Wärmeleitfähigkeit dieser Platten ist ebenfalls ein entscheidender Aspekt. Sie bewegt sich üblicherweise in einem Bereich von 0,03 bis 0,04 W/(mK), was vergleichsweise niedrig ist und eine hohe Dämmwirkung impliziert.
Berechnung Wärmedämmung
Ein herkömmliches Mauerwerk weist eine Wärmeleitfähigkeit zwischen 0,5 und 1,4 W/mK auf, was die Effizienz der EPS-Dämmplatten unterstreicht. Ein weiterer relevanter Wert ist der U-Wert, der Wärmedurchgangskoeffizient, der in direkter Verbindung mit der Wärmeleitfähigkeit steht. Auch hier gilt: Je geringer der U-Wert, desto effektiver ist die Wärmedämmung. Für eine Außenwand wird ein maximaler U-Wert von 0,15 W/m²K empfohlen, um optimale Dämmung zu gewährleisten.
Die Ökobilanz: Ist die Styropordämmung schlecht für die Umwelt?
Klassisch hergestelltes EPS ist auf Erdgas und Erdöl angewiesen, also auf begrenzt verfügbare fossile Rohstoffe. Die Herstellung verbraucht Energie und verursacht CO₂-Emissionen. Rechnet man diese ökologischen Kosten jedoch gegen und nimmt die Einsparungen an Heizenergie durch eine effiziente Dämmung in den Blick, hat Styropor eine positive Ökobilanz.
Das zeigt etwa das global am häufigsten eingesetzte EPS-basierte WDVS vom deutschen Hersteller Sto: Es verursacht nur etwa 20 Kilogramm CO₂ pro Quadratmeter in der Herstellung und spart zudem pro Quadratmeter Wohnfläche 1.100 Kilogramm CO₂. Diese Zahlen gelten für ein Haus mit sechs Wohneinheiten und für einen Zeitraum von 40 Jahren. Wird die Styropordämmung aus organischen Reststoffen hergestellt, verringern sich die CO₂-Kosten noch einmal signifikant.
Wie muss ich Styropor entsorgen?
Bei einer Sanierung fallen größere Mengen an Styropor an. Diese müssen Sie beim Recyclinghof entsorgen. Reines, sauberes Dämmmaterial aus Styropor kann vielfältig aufbereitet und weiterverarbeitet werden – etwa zu Granulat, das neuen Kunststoffprodukten zugesetzt wird. Gebrauchte Styropordämmungen werden auch gemahlen und in der Produktion von Styropor-Recyclingplatten eingesetzt.
Welche Alternativen gibt es zur Styropordämmung?
Styropor gehört zu den synthetischen Dämmstoffen, die in der Regel langlebig und kostengünstig sind. Alternativ gibt es organische Dämmstoffe: Dämmen können Sie etwa mit Flachs, Hanf, Holzfaser, Schafwolle oder Stroh. Sie werden aus nachwachsenden, natürlichen Rohstoffen gewonnen. Um ihre Brandschutzfähigkeiten zu verbessern, kombinieren die Hersteller von Dämmmaterialien diese oft mit künstlichen Materialien oder imprägnieren die Stoffe. Das macht einen Abstrich bei der Nachhaltigkeit. Eine dritte Variante ist die Fassadendämmung mit mineralischen Dämmstoffen wie Steinwolle oder Mineralschaum. Sie regulieren Feuchtigkeit besonders gut und müssen nicht weiterverarbeitet werden, um den Brandschutz zu gewährleisten.
Für den Inhalt dieses Artikels ist verantwortlich:

Sto SE & Co. KGaA
Ehrenbachstraße 1
79780 Stühlingen